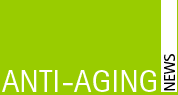Alternative Bezeichnungen: Kalium, K, Potassium, 19
Wo
Kalium kommt in tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln vor, wobei zu den besonders kaliumreichen Nahrungsmitteln Kartoffeln, grünes Gemüse (Spinat, Salat, Petersilie, Kohl), Hülsenfrüchte und Obst (hier besonders Bananen) zählen. Aber auch Getreide (z.B. Vollkornbrot) sowie Fleisch und Fisch rechnet man zu den ergiebigen Kaliumquellen.
Wirkung
Kalium ist für den Stoffwechsel jeder Körperzelle und die Aufrechterhaltung des zellulären Ruhepotentials wichtig. Zusammen mit Natrium, Kalzium und Chlor beeinflusst es die Herzmuskeltätigkeit und ist für die Erregbarkeit von Muskel- und Nervenzellen zuständig. Eine hohe Kaliumkonzentration verlangsamt die Herzfrequenz, eine erniedrigte Kaliumkonzentration im Blut erhöht die Erregbarkeit der Herzmuskulatur, was wiederum zu Herzrhythmusstörungen führen kann. Kalium ist auch an der Aktivierung einiger Enzyme (z.B. Oxidasen, Pyruvatkinase, glykolytische Enzyme) und Eiweiße, am Stoffwechsel von Kohlenhydraten und folglich an der Energieproduktion im Körper beteiligt. Darüber hinaus reguliert Kalium den Wasser-Elektrolyt-Haushalt und sorgt für die Erhaltung des osmotischen Drucks in den Zellen. Kalium beteiligt sich an der Aufrechterhaltung des Säure-Basen-Gleichgewichts und ist Bestandteil der Verdauungssäfte.
Indikation
- Funktionsstörungen der Herz- und Darmmuskulatur
- Bluthochdruck
- Herzrhythmusstörungen
- Starkes Schwitzen
Mögl. Indikationen
Ein Kaliummangel (Hypokaliämie) rangiert unter den häufigsten Formen der Elektrolytstörungen. Erbrechen, Durchfälle oder Missbrauch von Abführmitteln können einen Kaliummangel genauso verursachen wie eine vermehrte Ausscheidung über die Nieren, entzündliche Darmerkrankungen, Alkoholmissbrauch sowie verringerte Zufuhr von Kalium durch Essstörungen wie etwa Bulimie. Im hohen Alter besteht die Gefahr eines Kaliummangels durch Austrocknung bei zu geringer Flüssigkeitszufuhr. Starkes Schwitzen und körperliche Anstrengung können aber ebenfalls zu einem Kaliummangel führen. Lebensbedrohliche Elektrolytstörungen können bei Säuglingen und Kleinkindern nach Erbrechen und Durchfällen auftreten.
Eine medizinisch relevante Bedeutung besitzt das Kaliumpermanganat (KMnO4), das aufgrund seiner stark oxidativen Wirkung äußerlich als Antiseptikum zum Desinfizieren verwendet wird. Häufiger wird es aber als Desinfektionsmittelzusatz bei Spülungen und Bädern eingesetzt.
Dosierung
Für Erwachsene beträgt die empfohlene Menge an Kalium im Normalfall 2 bis 3,5 Gramm täglich. Kinder und Jugendliche benötigen für gewöhnlich 1 bis 2 Gramm/Tag. Für Kleinkinder wird die Einnahme von ca. 500 bis 700 Milligramm täglich empfohlen.
Herz-Kreislaufpatienten können gegebenenfalls mehr als das Doppelte der täglichen Normalmenge benötigen. Sie sollten deshalb mit ihrem Arzt Rücksprache halten. Eine Menge von zirka 10 bis 20 Gramm Kaliumsalze (KCL) kann tödlich sein.
Hinweise
Eine alimentäre Überdosierung ist bei gesunden Nieren unschädlich, da überschüssiges Kalium schnell ausgeschieden wird. Bei einer Schwächung der Nebennierenrinde (Addison-Krankheit) kann es zu einer Kaliumvergiftung mit Störungen der Muskel-, Nerven- und Herzkreislauffunktion sowie zu Verwirrtheit, Halluzinationen, Ohrensausen und Taubheit kommen. Eine Kaliumspiegelerhöhung im Blut (Hyperkaliämie) kann daneben auch durch diverse weitere Ursachen bedingt sein wie etwa erhöhte Zufuhr von Kalium über Infusionen oder Bluttransfusionen, durch Freisetzung von Kalium bei Traumen, Verbrennungen, Hämolyse (Untergang von roten Blutkörperchen durch Zerstörung ihrer Zellmembran), Azidose (Übersäuerung im Blut) und Infektionen sowie durch eine herabgesetzte Ausscheidung über die Nieren (Niereninsuffizienz).
Dialysepatienten erweisen sich als besonders empfindlich für Kaliumüberdosierungen. Zu viele Bananen können bereits ernsthafte Wirkungen auslösen. Außerdem ist zu beachten, dass Kalium bei gleichzeitiger Einnahme von herzwirksamen Glykosiden deren Wirkung vermindern kann.